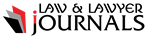Sie setzte sich jetzt auf ihren Sessel neben dem Sofa. Ich hatte wieder das Aufnahmegerät mitgebracht. Der Plan, ein Buch über sie zu schreiben, über unsere Familie, über ihre Beziehung zu meinem Vater, war in den letzten Jahren langsam gereift. Zunächst arbeitete er sich wie ein streunender Köter an mich heran, der wieder und wieder an mir herumschnüffelte, um kurz vor dem Abdrehen seine Duftmarke zu setzen.
Ja, anfangs fühlte es sich so an, als würde mir jemand ans Bein pinkeln. Freunde und Weggefährten ermunterten mich, diese Geschichte aufzuschreiben. Jeder begründete es auf seine Weise. Ich merkte, wie sie sich die Versatzstücke, die Episoden, die ich je nach Zuhörer variierend erzählte, aneigneten.
Für mich blieben diese Geschichten fremd und zugleich nicht fremd genug. Viele Lücken warfen Fragen auf, die ich mich nicht zu stellen getraute. Jeder Familienroman arbeitet mit seiner eigenen Grammatik, entwickelt seine eigenen Zeichen, seine Syntax, die ihn für die beteiligten Personen oft unlesbarer werden lassen als für den außenstehenden Betrachter.
Das Fremde wächst in der Nähe. Wie bei einem Baum das Wurzelwerk in Größe und Umfang dem Wipfel entspricht, so ist es auch hier. Fremd wurzeln wir im Verborgenen, greifen unter der Erde um uns und dehnen uns aus. Die Früchte, das, was wir sehen, heranreifend oder verfault, lebendig oder tot, korrespondieren mit dem, was wir in der Natur nicht sehen können und in der Familie nicht sehen dürfen. Dem Tabu. Jedes Kind erkennt es mit schlafwandlerischer Sicherheit.
Ich sah in ihr Gesicht. Sie trug ihr dünnes weißes Haar streng nach hinten zu einem kleinen Dutt gebunden. Die letzten zwanzig Jahre in Spanien hatten ihr gutgetan. Ihre Depression war in der Sonne ausgeblichen, sie hatte abgenommen und ihre Perücken ins Meer geworfen. Ein Akt der Befreiung, der mir eine Mutter zurückgab, die ich so fast nie gesehen hatte. Sie erinnerte von ferne an das zarte junge Mädchen auf einem Bild von 1932. Mit dreizehn Jahren waren ihre Haare dunkelbraun, der Blick traurig und ernst.
Jetzt saß sie vor mir, einundneunzigjährig, das geschrumpfte Gesicht beherrscht von ihrer geschwungenen Nase, die großen Hände, die immer noch neugierig nach allem griffen. Der im Alter wieder erschlankte Oberkörper hatte seine Spannung bewahrt.
Der süßliche Duft alten Lebens kroch mir in die Nase. Im Eingang hing die gelbe Baskenmütze meines Vaters an einem Haken. Er hatte sie auf seinem Sterbebett getragen. Vier Jahre waren seitdem vergangen. Wenn ich die Mütze sah, war sein Geruch noch immer in der Luft, als hätte er den Raum nicht endgültig verlassen, als könnte er sie jeder- zeit vom Haken nehmen und sich schweigend auf einen seiner langen Spaziergänge machen. Meine Mutter folgte meinem Blick.
„Dein Vater passte ja gar nicht zu mir.“ Es verschlug mir kurz die Sprache. Ein erstaunlicher Satz über zwei Menschen, die, mit einigen Unterbrechungen, ein Leben lang nicht voneinander hatten lassen können.
„Gab es denn jemand anders?“ – „Eigentlich nicht.“ – „Nie?“ – „Ich würde sagen, eigentlich nicht.“ Ich kannte andere Geschichten, aus anderen Zeiten, aber auch jetzt war eine andere Zeit angebrochen. Immer noch schaute sie auf seine gelbe Baskenmütze.
„Mein Vater hatte ihn im Tiergarten aufgegabelt. Und dann stand er an einem schönen blauen Sonntag vor unserer Tür. Gestiefelt und gespornt. Ich sah gleich, dass er sich nicht wohlfühlte. Dieser Anzug. Nein. Also wirklich, zum Piiiepen.“ Sie machte eine Pause. „Warst du gleich in ihn verliebt?“ – „Ich?“ – „Ja.“ Sie wiegte vorsichtig den Kopf. „An manches kann ich mich dann doch nicht mehr so genau erinnern, weißt du – aber wahrscheinlich schon.“ – „Und du warst damals …“ – „Dreizehn.“ – „Und er?“ – „Siebzehn.“
Ihr Kopf kippte leicht vor, als würde sie einnicken. Kurz darauf sprach sie weiter, die Augen halb geschlossen. „Mal sehen, wie lange er heute wieder braucht. Eigentlich eine Frechheit, er verschwindet, und es kommt ihm nicht in den Sinn zu sagen, wohin er geht oder wann er zurückzukommen gedenkt. Das geht nun schon ein ganzes Leben so. Uuuunglaublich.“
Im Mai 1915, bei der Schlacht von Gorlice-Tarnów, fiel der Barbier Otto Joos durch einen Schuss in die Brust, als er mit dem Bajonett die feindliche Linie stürmen wollte.
„Armer Steppke, keen Vata nich!“
In der Parterrewohnung eines dritten Kreuzberger Hinterhofs entband seine Frau Anna mithilfe der herbeigeeilten Nachbarin unter den Augen ihrer kleinen Tochter Erna einen Jungen. Das Baby war klein und wog gerade drei Kilo, trotzdem machte es einen erstaunlich kräftigen Eindruck. Die Geburt hatte zwanzig Minuten gedauert.
„Armer Steppke, keen Vata nich!“ Die Nachbarin schüttelte den Kopf. „Hör uff so zu berlinern. Das Kind soll was Besseres hören.“ Anna gab dem Kleinen die Brust. Sie war bemüht, so klar und vornehm wie möglich zu sprechen, verzog dann aber erschrocken das Gesicht. „Autsch. Der hatn juten Zug.“ – „Mensch, Anna, wat machste nu? Jetz haste nochn Maul su stopfen.“ Anna hörte nicht zu. Sie schaute ihren neugeborenen Sohn an. „So ’n Pech mit den Otto. Det dir aber ooch alle wegsterben. So’n Pech auch. Nee.“ – „Kannst gehen, Frau Kazuppke, die Erna hilft mir.“ Die Tür fiel ins Schloss.
Frau Kazuppke schüttelte noch ein paarmal den runden Kopf und wischte die blutigen Hände an ihrer fleckigen Schürze ab. Sie hatte schon einige Nachbarskinder zur Welt gebracht und andere zu den Engeln geschickt. Sie kannte das Leben, und sie wusste, dass mit diesem Jungen ein Problem mehr auf die Welt gekommen war.
Erna schlich auf ihren spindeldürren Beinen heran. Vorsichtig schob sie ihr scharfgeschnittenes Gesichtchen über die Schulter der Mutter. „Süß“, sagte sie trocken, „wie solla’n heeßen?“ – „Otto. Wie sein Vata.“ Erna nickte.
In der Schule war Otto der Kleinste und Schwächste. Seine Klassenkameraden traten an die Stelle des Vaters und verprügelten ihn tagein, tagaus. Als er sich wieder einmal das blut- und tränenverschmierte Gesicht über dem verdreckten Waschbecken der nach altem Urin stinkenden Schultoilette abwusch, betrachtete er sich im Spiegel und sah, dass sich etwas ändern musste.
Der kleine Otto
Von einer Baustelle klaute er nachts ein paar schwere Ziegelsteine und eine herumliegende Eisenstange. Er feilte die Löcher der Ziegel aus, sägte die Eisenstange zurecht und bastelte sich eine Hantel zusammen. Im Hof stand ein kleines Eisengerüst. Über die Stange warfen die Frauen ihre billigen Teppiche, um sie mit einem aus Rohr geflochtenen Klopfer zu bearbeiten. Anna hatte diese Arbeit ihrem Karl überlassen. „Tust ja sonst nischt.“ Von Liebe war keine Rede mehr. Wenn er sich auf sie legte, spreizte sie die Beine und stöhnte schnell und laut, damit’s ihm kam. Bald besann sich Karl darauf, dass man mit dem Teppichklopfer auch die Hintern seiner missratenen Familie bearbeiten konnte.
Jeden Morgen stand Otto nun zwei Stunden früher auf, schlich an seinem schnarchenden Stiefvater vorbei, der meistens auf der Couch im Wohnzimmer übernachten musste, goss sich in zorniger Erinnerung an seine Peinigerin Irmgard einen Kübel eiskalten Wassers über den nackten Körper, holte, in Unterhose und Feinripp, seine Hantelstange aus dem Kellerversteck und ging auf den Hof, um zu trainieren.
Anfangs gelang es ihm kaum, das Gewicht in die Höhe zu stemmen, sich an der Teppichstange hochzuziehen oder sich mehr als dreimal vom Boden in den Liegestütz zu drücken. Aber er wusste, wenn er jetzt aufgeben würde, wäre er für immer verloren. Die Lektion war klar und einfach: Prügel kriegen oder austeilen. Er war sich nicht einmal sicher, ob er austeilen wollte, aber er wusste, dass er nicht mehr einstecken durfte. Nach ein paar Wochen wurden die Ziegel zu leicht. Er befestigte zwei volle Bierkästen, die er seinem lallenden Stiefvater im Halbschlaf unter dem Bett weggezogen hatte, mit einem Seil an der Eisenstange und steigerte sich von drei Fünfersätzen zu vier Sätzen à dreißig.
Anna sah ihrem Sohn vom Fenster aus zu und schwieg. Sie hatte verstanden. Wann immer es Kartoffeln gab oder gar Butter und Brot, legte sie es für Otto beiseite. Ein halbes Jahr später war Otto immer noch unverändert klein, aber aus all seinen Sachen herausgewachsen. Muskelbepackt trat er den Schulweg an, der so lange sein Kreuzweg gewesen war.
Paul Meister, Ottos Erzfeind, den alle ehrfürchtig Paule nannten, war nicht der Hellste in der Klasse, aber mit seinen Fäusten war er schneller als jeder Streber beim Einmaleins. Wer sich seinem Willen widersetzte, den trommelte er zu Boden. Und da er auch im Sprechen nicht der Wendigste war, befehligte er seine Truppen mit Blicken.
Das Fußballspiel
Es war ein Montagmorgen im Dezember. Auf dem Schotter des Schulhofs lag kalt der Raureif. In der ersten großen Pause teilte Paule mit ein paar herrischen Gesten zwei Mannschaften zum Fußballspiel ein. Otto stand absichtslos in einer Ecke. Sorgfältig packte er das Butterbrot aus, das seine Mutter ihm mitgegeben hatte. Das dreckverschmierte Leder traf ihn mit voller Kraft ins Gesicht. Schießen konnte Paule. Seine Claqueure grölten vor Freude.
„Otto der Doofe kackt sich inne Hose“, schrie ein dünner, pickeliger Knabe. „Otto der Schlappschwanz schiebt sich Butterbrote in den Wanst“, setzte ein rotgesichtiger Junge nach, der sich hinter Paule versteckt hielt. Seine Arme standen weit vom dicken Körper ab, als hätte ihm jemand die Krücken weggerissen.
Siegesgewiss stolzierte Paule auf Otto zu. Er blieb vor ihm stehen. Mit einem kurzen Blick aus den Augenwinkeln bedeutete er Otto, seinen Platz in der Mannschaft einzunehmen. Dann geschah alles sehr schnell. Otto verpasste ihm mit seiner Rechten einen Leberhaken. Während Paule fast erstickte, krachte Ottos Linke zuerst mit der Faust und dann mit dem Ellenbogen in sein Gesicht und zertrümmerte ihm Nase und Jochbein.
Blau-weiße Milch
Als Otto auf ihm lag und sein Gesicht wie einen alten Lappen über den Schotter riss, konnte Paule sich nicht mehr genau daran erinnern, ob er erst etwas gesagt hatte, um dann Otto das Butterbrot aus der Hand zu hauen, oder ob es umgekehrt gekommen war. Die Claqueure wichen stumm zurück. Hilfe suchend streckte Paule ihnen sein blutendes Gesicht entgegen. Keiner rührte sich. Alle starrten ehrfürchtig zu Otto. Er war der neue König. Gleichgültig schlenderte er vom Platz.
Ein älterer Junge kam ihm von der anderen Seite des Schulhofs entgegen, als sich alle verkrümelten. Er streckte Otto die Hand entgegen. „Roland.“
Otto sah ihn schweigend an. Er kannte den Unterprimaner vom Hörensagen. Um solche Leute hatte er immer einen Bogen gemacht. Sie würden ihn sowieso nie beachten. Jetzt sah er ihm zum ersten Mal in die Augen. Blau-weiße Milch, dachte er.
Roland war wenig größer als er. Seine knotigen Hände hingen locker, aber in leichter Spannung vom Körper, eigenartig abgewinkelt, die Beine in entspannter Bereitschaftsstellung. Ein Kämpfer. Otto erkannte es sofort. Er schlug ein.